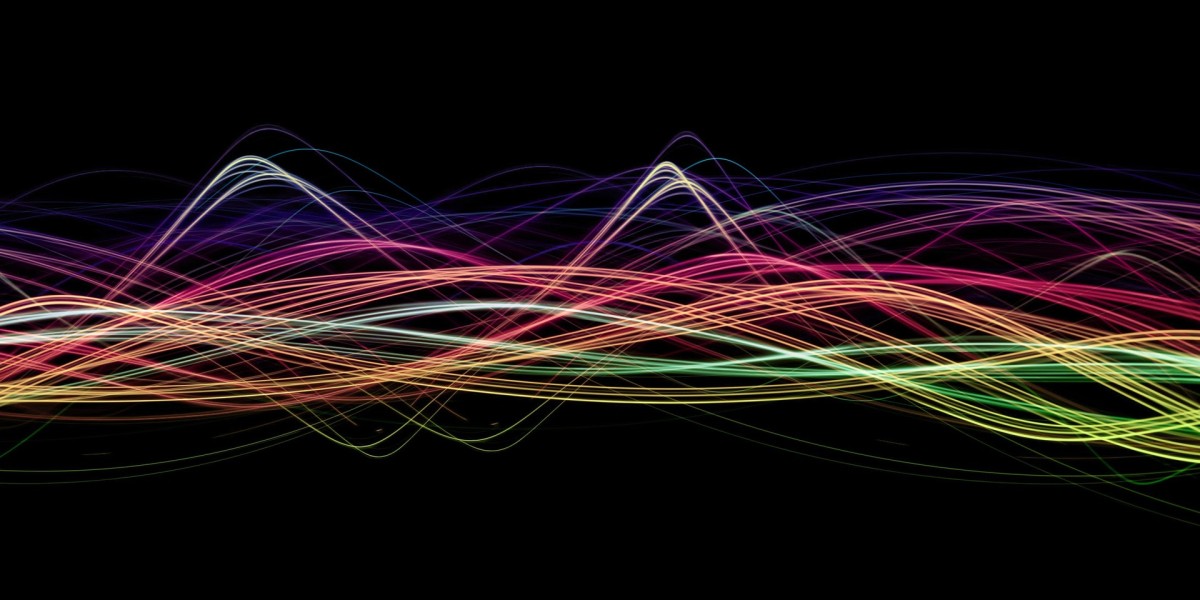Wachstumshormon (GH) ist ein körpereigenes Peptid, das von der Hirnanhangdrüse produziert wird. Es steuert die Zellteilung, den Stoffwechsel und die Muskel- sowie Knochenentwicklung. In jüngerer Zeit hat sich GH in der medizinischen Praxis als vielseitiges Mittel etabliert – sowohl bei Wachstumsstörungen im Kindesalter als auch bei bestimmten Erkrankungen von Erwachsenen.
---
- Medizinische Anwendungsgebiete
- Wirkungsmechanismen
- Insulin-ähnliche Wirkung: GH erhöht die Insulinresistenz, was den Glukoseverbrauch in Zellen beeinflusst.
- Anabole Effekte: Förderung von Protein-synthese und Zellteilung, insbesondere im Muskelgewebe.
- Knochenanpassung: Stimuliert Osteoblasten und reduziert Osteoklastaktivität, wodurch die Knochenmineraldichte steigt.
- Dosierung & Verabreichung
- Nebenwirkungen & Risiken
- Ödeme
- Gelenkschmerzen
- Erhöhte Insulinresistenz
- Risikofaktor für Tumorwachstum (bei bestehenden Krebserkrankungen)
- Der digitale Diskurs
- Qualität der Quellen: Seriöse wissenschaftliche Publikationen sind zu bevorzugen.
- Rechtlicher Status: In vielen Ländern ist der Verkauf von GH ohne ärztliches Rezept illegal.
- Kosten-Nutzen-Analyse: Die langfristigen Kosten (inkl. Arztbesuche, Bluttests) übersteigen oft den kurzfristigen Nutzen.
- Fazit
| Indikation | Ziel des Treatments |
|---|---|
| Wachstumshormonmangel (GHD) | Erhöhung der Körpergröße, Verbesserung der Knochenstruktur und des Stoffwechsels |
| Prä- und Postoperatives Management | Beschleunigte Heilung nach Operationen, besonders bei Knochendefekten |
| Sarkopenie & Muskeldegeneration | Erhalt bzw. Wiederherstellung von Muskelmasse und Kraft |
| Chronische Niereninsuffizienz | Verbesserung der Lebensqualität durch Stimulation des Stoffwechsels |
---
| Patientengruppe | Empfohlene Tagesdosis (µg/kg) | Gabeform |
|---|---|---|
| Kinder mit GHD | 0,025–0,05 | Subkutane Injektion |
| Erwachsene mit GHD | 0,03–0,06 | Subkutane Injektion |
| Sportliche Athleten (nicht-medizinisch) | Nicht empfohlen | Subkutane oder intramuskuläre Injektion |
---
Das Wachstumshormon (GH) ist ein Peptidhormon, das von der Hypophyse produziert wird und eine zentrale Rolle bei der Regulation des Stoffwechsels sowie des Wachstums und der Entwicklung spielt. Es wirkt auf zahlreiche Gewebe im Körper, insbesondere auf Knochen, Muskeln und Fettgewebe, und beeinflusst die Synthese von Proteinen, den Kalziumstoffwechsel und die Glukoseproduktion. GH ist auch an der Aufrechterhaltung des Muskel- und Knochenvolumens sowie an der Modulation des Immunsystems beteiligt.
Im Blutkreislauf existiert das Wachstumshormon in unterschiedlichen Formen: freies (ungebundenes) GH, welches biologisch aktiv ist, und gebundenes GH, das mit spezifischen Proteinen wie der Growth Hormone Binding Protein (GHBP) verpackt ist. In Laboranalysen wird meist der freie GH-Wert gemessen, da dieser den aktuellen physiologischen Status besser widerspiegelt.
Der Laborwert für GH gibt an, in welcher Menge des Hormons im Blut vorliegt. Ein niedriger Wert kann auf eine Hypopituitarismus oder ein Wachstumshormondefizit hinweisen, was bei Kindern zu Wachstumsverzögerungen und bei Erwachsenen zu einer erhöhten Fettmasse sowie einer verringerten Muskelkraft führen kann. Ein hoher GH-Wert hingegen kann ein Hinweis auf eine Akromegalie sein – eine Erkrankung, die durch Überproduktion des Hormons gekennzeichnet ist und mit Symptomen wie vergrößerten Händen, Füßen, Gesichtszügen und Organvergrößerungen einhergeht.
Die Messung von GH erfolgt in der Regel mittels immunochemischen Verfahren. Da das Hormon im Blut schwankende Konzentrationen aufweist, werden häufig mehrere Messpunkte über einen Zeitraum hinweg erfasst (zum Beispiel in 30-min-Intervalle) oder es wird ein stimulierender Test wie die Somatostatin-Blockade durchgeführt, um die maximale Ausschüttung zu beurteilen. Der daraus resultierende Laborwert kann dann mit Referenzbereichen verglichen werden, die je nach Altersgruppe, Geschlecht und Labormethode variieren.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Laborwert GH ein wichtiges diagnostisches Werkzeug ist, um Störungen im Wachstumshormonstoffwechsel zu identifizieren. Er liefert entscheidende Hinweise auf sowohl hormonelle Defizite als auch Überproduktionszustände und bildet damit die Basis für eine gezielte therapeutische Intervention.